Anlässlich der Bundestagswahl 2017 haben wir mit Sozialwissenschaftlerin Dagmar Müller vom Deutschen Jugendinstitut e.V. in München gesprochen. Als wissenschaftliche Referentin der Fachgruppe „Familienpolitik und Familienförderung“, weiß sie, wie sich Familien entwickeln, was sie in ihrer Lebensführung am meisten benötigen und welche Auswirkungen familienbezogene politische Maßnahmen haben.

Bildnachweis: DJI/David Ausserhofer
Was sind gegenwärtig die größten Herausforderungen für Familien?
Familien sehen sich heutzutage mit vielen, teils widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert. Beide Elternteile sollen, wenn möglich, einem Beruf nachgehen, sich Haushalt und Kindererziehung partnerschaftlich teilen, ihren Kindern die beste Bildung und Erziehung vermitteln, Termine und alltägliche Pflichten wahrnehmen, ihre älteren Angehörigen pflegen und bei allem auch noch genügend Zeit und Muße für sich selbst finden. Gleichzeitig sind die familialen Strukturen und Rollenverteilungen komplexer geworden. Während in den 50er, 60er Jahren noch die Ehegattenfamilie die vorherrschende Familienform war, bei dem der Mann arbeiten ging und die Frau sich um die Kinder kümmerte, sind die Familienformen heute mit mehr Alleinerziehenden, gleichgeschlechtlichen Paaren, Patchwork- und Inseminationsfamilien um einiges vielfältiger und dynamischer geworden. Das führt dazu, dass Eltern die gesellschaftlichen Erwartungen immer wieder neu austarieren müssen, was nicht immer leicht ist.
Auch finanziell haben Eltern einiges zu stemmen. Was belastet den Geldbeutel von Familien am meisten?
Kinder sind zwar eine Bereicherung, aber sie kosten auch Geld. Heute noch mehr als früher, da sie in der Regel in jüngerem Alter in die Kita kommen, früher ein Handy benötigen und Statussymbole wie Markenklamotten einen höheren Stellenwert besitzen. Besonders in Großstädten sind Familien zudem durch hohe Miet- und Mobilitätskosten belastet.
Was tut denn die Politik, um Familien in ihrer Lebensführung finanziell zu unterstützen?
Sie versucht zum Beispiel, die Familien steuerlich durch Kindergeld und Kinderfreibeträge zu entlasten. Allerdings profitieren davon vor allem Familien mit mittleren und höheren Einkommen. Denn wer mehr verdient, bekommt über den Freibetrag eine höhere Steuerentlastung. Wer wenig oder gar nichts verdient, bekommt nur das Kindergeld. Zudem gibt es große Zweifel, ob Kindergeld und Kinderfreibetrag das Existenzminimum von Kindern tatsächlich decken. Daher wird derzeit viel diskutiert über eine mögliche Kindergrundsicherung, d.h. eine Bündelung der verschiedenen staatlichen Leistungen, um allen Kindern unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Die vorgeschlagenen Konzepte sind aber noch recht vage.
Wie beurteilen Sie die derzeitigen familienpolitischen Maßnahmen?
Einiges läuft bereits ganz gut. Beispielsweise kann das einkommensabhängige Elterngeld durchaus als Erfolgsgeschichte gewertet werden. Zum einen hat es vielen jungen berufstätigen Paaren erleichtert, sich für Kinder zu entscheiden. Zum anderen engagieren sich deutlich Väter mehr in der Betreuung ihrer Kinder. Mehr als jeder dritte Vater nimmt mittlerweile Elterngeld in Anspruch, um sein Kind nach der Geburt selbst (mit) zu betreuen. Vor Einführung des Elterngelds nahmen gerade einmal drei Prozent der Väter „Erziehungszeit“. Gleichzeitig fällt es Müttern leichter, nach der Geburt wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.
Und woran sollte die Politik noch weiterarbeiten?
Dringender Handlungsbedarf besteht zweifellos bei der Vermeidung von Kinderarmut und ihren negativen Folgen. Rund 1,6 Millionen Kinder unter 15 Jahren sind in Deutschland auf Hartz IV-Leistungen angewiesen. Vor allem bei Alleinerziehenden reicht oft das Erwerbseinkommen nicht zum Lebensunterhalt aus. Was die ehe- und familienbezogenen Leistungen betrifft, tragen diese oftmals dazu bei, Ungleichheiten zu verstärken. Noch immer profitieren Paare mehr als Alleinerziehende, Eltern mit höherem Einkommen mehr als Geringverdiener und Paare, in denen es nur einen Verdiener gibt, mehr als jene, in denen beide Partner berufstätig sind. Viele Familien kennen ihre Ansprüche außerdem gar nicht oder nutzen sie nicht, wenn ihnen die Prozesse zu bürokratisch erscheinen. Das betrifft zum Beispiel den Kindergeldzuschlag bei erwerbstätigen Alleinerziehenden. Dadurch kommen viele der bisherigen Förderungen gar nicht bei den Betroffenen an.
In den Parteiprogrammen zur Bundestagswahl fordern einige Parteien, die Betreuungsgebühren für Kindertageseinrichtungen zu reduzieren oder diese sogar gänzlich zu erlassen. Was halten Sie davon?
Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung hat einen hohen Stellenwert, da er die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützt, die Erwerbstätigkeit von Frauen trotz eigener Kinder ermöglicht und die Bildung der Kinder im Kleinkindalter fördert. Ein wichtiger Meilenstein wurde bereits mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erreicht. Aber es stimmt, dass neben qualitativen Mängeln auch die Betreuungskosten bei vielen Eltern für großen Ärger sorgen. Knapp die Hälfte der Eltern ist mit den anfallenden Kosten bei der Kinderbetreuung unzufrieden. Eine Senkung der Kosten wäre also prinzipiell gut, um ihren Interessen entgegen zu kommen. Eine komplett kostenlose Betreuung für die Familien halte ich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt für schwierig, denn auch die Qualität kostet Geld und muss an einigen Stellen noch verbessert werden. Zudem haben Modellrechnungen des Familienökonomen Holger Stichnoth ergeben, dass eine Kostenbefreiung der Eltern das Armutsrisiko nur minimal verringern würde. Der sinnvollste Weg scheint mir daher, eine einkommensabhängige Beitragsstaffelung zu sein.
Wäre es besser, das Problem über die Erhöhung des Kindergeldes anzugehen, wie es ebenfalls von einigen Parteien gefordert wird?
Eine Erhöhung des Kindergeldes nach dem Gießkannenprinzip wäre nicht zielführend. Zwar hätten die Eltern, die keinen Anspruch auf steuerliche Freibeträge haben, dann kurzfristig mehr Geld in der Tasche. Aber bei steigenden Einkommen würde auch die Schwelle der Armutsgefährdung steigen. Im Endeffekt hätten wir also nur einen Fahrstuhleffekt. Außerdem könnte ein hohes Kindergeld von Müttern als Anreiz verstanden werden, nicht erwerbstätig zu werden.
A propos Erwerbstätigkeit: Ein weiteres Thema, das die Politik und viele Eltern beschäftigt, ist die partnerschaftliche Arbeitsteilung und mehr Gleichstellung. Wie ist es darum momentan bestellt?
Dazu ist bereits einiges in Bewegung, siehe Elterngeld oder die Frauenquote in Führungspositionen. Allerdings ist vieles davon nur ein Lippenbekenntnis; an der praktischen Umsetzung hakt es noch. Beispielsweise ist es nach wie vor so, dass die meisten Väter nur die zwei Partnermonate Elternzeit nehmen. Außerdem geraten besonders Frauen noch oft in die Armutsfalle, wenn diese nur Teilzeit oder gar nicht arbeiten und sich am Ende von ihrem Partner trennen. Auch die Entgeltgleichheit von Frauen und Männern sollte weiter vorankommen. Die Unterschiede sind noch immer sehr groß.
Ihre Botschaft an die Politik?
Allein mit mehr Geld wird man die anstehenden Herausforderungen nicht meistern. Wie bereits der Siebte Familienbericht deutlich gemacht hat, braucht es den „Dreiklang“ von Geld-, Zeit- und Infrastrukturpolitik für eine nachhaltige Familienpolitik.
Und zum Schluss noch Ihr Wunsch für Familien?
Ich beobachte, dass viele junge Eltern beim Jonglieren mit all den Ansprüchen und Erwartungen sehr gestresst sind. Ich würde mir für sie flexiblere und verlässlichere Rahmenbedingungen wünschen, damit sie sich nicht mehr so verrückt machen müssen und die positiven Seiten des Familienlebens entspannter erleben und genießen können.
Herzlichen Dank.
Tipp: Familien, die wissen möchten, auf welche Familienleistungen oder -hilfen sie einen Anspruch haben, ist die Webseite des Bundesfamilienministeriums Infotool-Familie.de zu empfehlen.
Kurzumfrage: Welche Partei finden Sie am familienfreundlichsten?
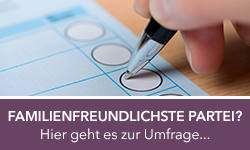
Weitere Artikel rund um das Thema Familienpolitik zur Bundestagswahl 2017
Wahlversprechen kostenfreie Kitas – Wo Eltern nach der Bundestagswahl am meisten sparen könnten




