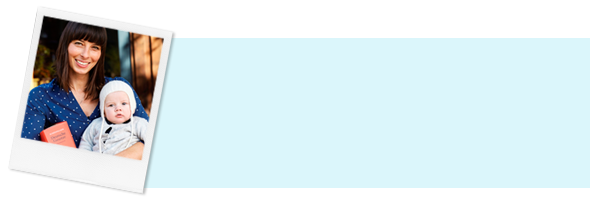Die Betreuungsfrage ist mit Sicherheit eine der brennendsten Fragen, die werdende berufstätige Eltern beschäftigt: Ab wann und wo gebe ich mein Kind in fremde Hände? Finde ich auch rechtzeitig eine Betreuungseinrichtung, in der mein kleiner Schatz liebevoll betreut wird? Und was bedeutet es eigentlich, einen „Rechtsanspruch“ auf Kinderbetreuung zu haben? Kann ich mich wirklich „einklagen“, wenn ich keine Zusage von meiner Wunsch-Kita oder Wunsch-Tagesmutter erhalte?
Der Kitarechtsanspruch – ab wann er mir zusteht und welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen
Entscheidend für den Umfang des Rechtsanspruchs ist vor allem das Alter des Kindes: Der Anspruch entsteht mit dem Erreichen bestimmter Altersgrenzen, knüpft aber auch an den beruflichen „Status“ der Eltern an:
- Kinder von 0 – 1 Jahren: Wenn es für die Entwicklung des Kindes geboten ist und die Eltern erwerbstätig, arbeitssuchend oder in einer Ausbildung sind, besteht der Rechtsanspruch auf Betreuung in der Kita oder bei einer Tagesmutter.
- Kinder von 1 – 3 Jahren: Der Rechtsanspruch auf einen Kita- oder Tagesmutter-Platz besteht unabhängig vom beruflichen Status und entsteht mit dem 1. Geburtstag.
- Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt: Auch hier muss das Kind eigentlich „nur“ seinen 3. Geburtstag feiern, der Rechtsanspruch besteht jedoch nur auf eine Unterbringung in einer Kita, jedoch nicht mehr bei einer Tagesmutter.
Ein Rechtsanspruch auf die Wunschkita? Schön wär’s.
Viele Eltern freuen sich, wenn sie erfahren, dass Ihnen der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zusteht, sind dann aber enttäuscht, wenn es in der Praxis nicht mit der Wunsch-Kita klappt. Tatsächlich ist ein Platz in der Wunsch-Kita oft Glückssache, denn die Behörden erfüllen ihre Pflicht, indem sie den Eltern einen freien und wohnortnahen Kitaplatz anbieten. Was genau unter „wohnortnah“ zu verstehen ist, wird im Gesetz nicht geregelt und ist Auslegungssache. Einige Gerichte haben bereits entschieden, dass Eltern 30 Minuten Fahrtzeit oder Fußweg in Kauf nehmen müssen.
.
Tipp: Wenn der angebotene Betreuungsplatz nicht zumutbar ist – zum Beispiel, weil er zu weit vom Wohnort entfernt ist, sollte gegen die Zuweisung des angebotenen Betreuungsplatz bei der zuständigen Behörde Widerspruch eingelegt und genau begründet werden, warum dieser unzumutbar ist (Fahrzeiten, schlechte Verkehrsverbindung, mangelnde Förderung des Kindes, etc.)
Der Betreuungsumfang – entscheidend ist der individuelle Bedarf der Eltern
Nicht selten kommt es vor, dass die Eltern endlich einen Betreuungsplatz für ihr Kind erhalten, dann aber mit Erschrecken feststellen: Die zugesprochene Betreuungsdauer stimmt nicht mit der beantragten Stundenanzahl überein. Auch hier kann es sich lohnen, gegen die behördliche Entscheidung Widerspruch einzulegen. Die Behörden entscheiden nämlich nach dem „individuellen Bedarf“ – einem unbestimmten und demzufolge „schwammigen“ Rechtsbegriff.
.
Die Ämter orientieren sich bei ihrer Entscheidung am Förderbedarf des Kindes und am zeitlichen Umfang der beruflichen Verpflichtungen der Eltern. Hinzu kommt, dass sich die Vorgaben und Empfehlungen in den einzelnen Bundesländern unterscheiden, so dass es oft einen Unterschied macht, in welchem Bundesland das Kind in die Kita geht: In Berlin umfasst der Betreuungsumfang für Kinder ab dem 1. Lebensjahr beispielsweise regelmäßig fünf Stunden, in Thüringen sind es 10 Stunden täglich.
.
Tipp: Wichtig ist daher, sich rechtzeitig mit den landesspezifischen Regelungen vertraut zu machen und entsprechende Nachweise zügig einzuholen (z.B. Bescheinigung des Arbeitgebers über die Arbeitszeit).
Wenn es mit dem Kitaplatz nicht klappt – die gerichtliche Geltendmachung des Rechtsanspruchs
Eltern sollten möglichst frühzeitig die zuständige Behörde über den Betreuungsbedarf informieren und einen Betreuungsplatz beantragen. Auch hier sollte man sich beim zuständigen Jugendamt informieren, da sich die Verfahren und Anmeldefristen (häufig 6 – 3 Monate vor Betreuungsbeginn) in den einzelnen Bundesländern unterscheiden.
.
Falls die Behörden keinen Betreuungsplatz vermitteln und der Berufsstart näher rückt, besteht die Möglichkeit, gegen einen ablehnenden Bescheid Widerspruch einreichen und ggf. Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht einlegen, notfalls im Eilverfahren. Wichtig ist dabei, dass man sich einzelnen Absagen der Kitas schriftlich geben zu lassen, damit diese dokumentiert sind.
.
Parallel sollte man sich unbedingt eine alternative Betreuung für das Kind organisieren, z.B. Oma und Opa, einen Babysitter, vielleicht sogar ein Au-pair. Gleichzeitig sollte man die aufgewendeten Betreuungskosten, den Verdienstausfall oder aufgewendete Urlaubsansprüche als Schadenersatz geltend machen. Wie erfolgsversprechend das ist, lässt sich derzeit aber noch nicht vorhersagen, da eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs dazu noch aussteht.